Disjunkte Hexachorde
In Analogie zu disjunkten bzw. konjunkten Tetrachordverbindungen des antiken Systema teleion verwenden Gaston Allaire, 1972 und Christian Berger, 1992 [21]Berger, Christian: Hexachord, Mensur und Textstruktur. In: Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, hrsg. von Hans Heinrich Eggebrecht, Band XXXV. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1992 S. 89 diese beiden Begriffe, welche der Terminologie des Mittelalters entstammen (völlig legitim) auch in Zusammenhang mit der von Anbeginn an üblichen Kombination zweier (oder mehrerer) Hexachorde.
Disjunkte Hexachord- Kombination
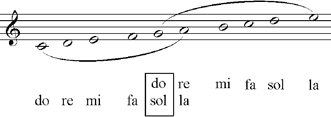
Die zwei Tetrachorde der Gattung do – re – mi – fa haben keinen gemeinsamen Ton.
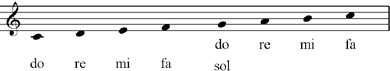
Das ist z. B. die Tetrachord- bzw. Hexachordordnung des XI Modus (Ionicus). Mutationspunkt ist das g1 (sol do), das heißt: im Aufsteigen wird das erreichte sol in Gedanken zunächst mit einer Doppelsilbe belegt (sol – do). Sobald das innere Ohr die Bedeutung der neuen Silbe als Basis-Ton einer neuen (Hexachord-) Ebene erfasst hat, kann mit den Silben des oberen Hexachords weiter gesungen werden. Analog dazu verwandelt man im Absteigen ein do in ein sol. Da die (relativ moderne) Silbe si den Gedanken an einen Sphärenwechsel innerhalb der Oktave erst gar nicht aufkommen lässt und daher auch im Sinne der strengen Kontrapunkt-, Modus- und Hexachordlehre tatsächlich bewusstseinsverengend wirkt, war sie in der konservativen Tonsatzlehre verpönt (so bei Sweelinck, Buttstett und Fux).
Der Bach’sche Denkspruch Fa Mi et Mi Fa est tota Musica, in Verbindung mit ausgerechnet dieser Art von Ostinato-Melodie weist auch auf diesen Umstand diskret hin. Denn eine Silbe si ist im Stile antico tatsächlich nicht von Nöten.