Guido von Arezzos (ca. 992–1050) System von ineinander verschachtelten Hexachorden war es letztlich zu verdanken, dass diese beiden Grundprinzipien der griechisch-antiken Musikanschauung praxisorientiert Eingang in die abendländische Musiktheorie fanden. [18]Daniel, Thomas: Kontrapunkt. Eine Satzlehre zur Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts. Verlag Christoph Dohr, Köln 2002 S. 73–76
Vor das Problem gestellt, die unter Punkt 2 angeführte Prämisse innerhalb eines diatonischen – und damit gesangstechnisch einfacher zu handhabenden Modells zusammenzufassen, kam Guido vermutlich auf die Idee der Hexachorde. Es dürfte ihm dabei nicht entgangen sein, dass alle drei Gattungen der Diatessaron auch in rein diatonischer Form darstellbar sind. Auf diese Weise zusammengefasst bzw. ineinander verschränkt ergeben sie dann in Summe eine Sechstonreihe – in nachstehendem Beispiel das Hexachordum durum.
Dazu wieder Keplers Darstellung (»Über die Tetrachorde und den Gebrauch der Silben ut, re, mi, fa, sol, la. [19]Kepler, Johannes: Weltharmonik In Fünf Büchern. (Deutsche Übersetzung) übersetzt und eingeleitet von Max Caspar. Fünfter, unveränderter reprographischer Nachdruck von 1939, hrsg. Im Auftrag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München. R. Oldenbourg Verlag GmbH, München 1990 S. 142 )
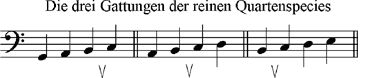
Beanspruchter Tonraum: Hexachordum durum
![]()
Dieser, alles diesbezüglich Wesentliche zusammenfassende, sechstönige Skalenausschnitt – im Spätbarock dann »Prinzipalhexachord« [20]Buttstett, Johann Heinrich: Ut, Mi, Sol, Re, Fa, La, tota Musica et Harmonia Aeterna. Erfurt 1716, S. 121 genannt, ermöglichte es nun die drei melodisch verschiedenen Quarten-Gattungen (oder anders formuliert: »die drei Gattungen der reinen Quarten – Spezies Diatessaron«) individuell, vor allem aber praxisgerecht, das heißt: für die Sänger relativ einfach zu solmisieren.
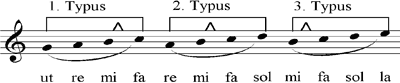
Ende des Exkurses